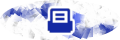Die Preußischen Reformen.
In freier Athmosphäre mit offenem Geist.
Die Ideen und Werke des Königsberger Philosophen Immanuel Kant nutzte zur Jahrhundertwende (18./19. Jahrhundert) eine ganze Generation junger, gebildeter Menschen, sich alternativen Lebensentwürfe zu verschreiben [A].
Wilhelm von Humboldt, ein Freund Schillers und Goethes, bis dahin preußischer Ministerresident (Botschafter) in Rom, zeigte sich 1809, nach Königsberg zurückbeordert, von der dort herrschenden, freien Atmosphäre und dem offenen Geist überrascht [ 1]:
»Die Art, wie man hier ist, ist mir sehr neu und überraschend gewesen. Unleugbar hat sich alles sehr verändert, und ich wage es zu sagen, zum Besseren. …es ist doch gewiß durch alle Stände mehr Hinneigen und Hängen zu und an Ideen, es ist daher auch für alles, was auf Ideen beruht (und es ist wieder sehr Stimmung, alles daran zu knüpfen), also für Wissenschaft und Kunst mehr zu erwarten.«
Der von Immanuel Kant ins Licht der gelehrten Öffentlichkeit katapultierte Johann Gottlieb Fichte verlor auf Betreiben Kur-Sachsens im April 1799 seine Professur in Jena. Und wie schon 100 Jahre zuvor Christian Thomasius bot Preußen auch Fichte Heimstatt und Wirkungsstätte, wenn auch erst nach Intervention von höchster Stelle, des Königs von Preußen [ 2]. Fichtes Wissenschaftslehre beeindruckte - unter anderem auch Süvern [ 3], dem wenig später die Reform des gymnasialen Unterrichtes oblag.
Im
Eine Regierung die das Vertrauen der Bevölkerungsmehrheit verloren hat, wird auf die eine oder andere Weise verschwinden. Fichte entwickelte eine Vorstellung, welches Verhältnis (welchen Contrat Social) Regenten und Bevölkerung bei sich stetig ändernden Bedingungen vernünftigerweise miteinander einzugehen haben [ 5].
Die 1807 einsetzenden preußischen Reformen verankerten die Grundrechte der Menschen in einer Weise, die sie die Zeit der Restauration überstehen ließen und im Fortlauf der Geschichte zum Ausgangspunkt weiterer Reformen (z.B. das Genossenschaftsgesetz Preußen 1867, der in gleicher, geheimer und freier Wahl bestimmte deutsche Reichstag 1871 und die Sozialgesetzgebungen ab 1888) werden ließen.
Durch die Bildung eines preußischen Beamtenadels existierte in Preußen eine starke, gebildete Bevölkerungsgruppe, die den Einfluß des sich aus der Feudalwirtschaft entwickelnden Landadels zurückdrängte. Mit der Niederlage bei Jena und Auerstedt setzte König Friedrich Wilhelm III. im Krieg und Frieden auf die Reformer. und weitere wurden in die ihnen entsprechenden Positionen berufen. Bereits 1807 hatte der König Karl August von Hardenberg mit der Leitung des Zivilkabinettes betraut [ 6].

Die Reform des Heeres, durch Scharnhorst, Gneisenau und Blücher, mußte aus vielen Gründen mit der Reform des gesamten Staates einhergehen. Die Befreiung von der napoleonischen Herrschaft bot unter der Perspektive damit die Voraussetzungen zur Befreiung des Menschen „aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ (wie das Kant formuliert hatte) zu schaffen, den Menschen in ganz Deutschland einen Anreiz an diesem Befreiungskrieg teilzunehmen.
Hardenberg in seiner von König Friedrich Wilhelm III. veranlaßten Rigaer Denkschrift »Ueber die Reorganisation des preußischen Staates« vom 12. September 1807: »Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung, dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist. Die reine Demokratie müssen wir noch dem Jahre 2240 überlassen, wenn sie anders je für die Menschen gemacht ist. Mit derselben Kraft und Konsequenz, womit Napoleon das französische revolutionäre System verfolgt, müssen wir das unserige für alles Gute, Schöne, Moralische verfolgen, für dieses Alles, was gut und edel ist, zu gewinnen trachten. Ein solcher Bund, ähnlich dem der Jakobiner, nur nicht im Zwecke und in der Anwendung verbrecherischer Mittel, und Preußen an der Spitze, könnte die größte Wirkung hervorbringen, und wäre für dieses die mächtigste Allianz[ 7].«
Eine zentrale Bedeutung kam daher der Bildungsreform zu. Hier berief König Friedrich Wilhelm III. Wilhelm von Humboldt. Gemeinsam mit anderen hochkarätigen Wissenschaftlern schuf Humboldt innerhalb eines Jahres ein Bildungssystem, das die Bildung des Menschen zu einem freien Charakter gewährleistete. Dies Ideal wurde, offen oder versteckt, bis in die frühen Jahre der Bundesrepublik Deutschland, verfolgt. Heute werden Schüler und Studenten auf eine Eigenschaft reduziert, Wissen anzueignen und wiederzugeben.
Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein.
Daß beides, Monarchie und freie Entfaltung des Menschen, wie auch der Gesellschaft kein Widerspruch ist, ergibt sich aus den die Gemeinden betreffenden Reformen des Freiherr vom und zum Stein. Stein übertrug den Gemeinden die nötigen Rechte und Pflichten, ihre eigenen Belange zu regeln, ohne übergeordnete Institutionen einbeziehen zu müssen.
Stein entstammte einer Familie von Reichsrittern, d.h. unmittelbar dem Kaiser unterstellten Rittern. Er verabscheute die Zersplitterung Deutschlands, das aus über hundert Einzelstaaten bestand und verspottete die Kleinfürsten als „Zaunkönige“. Steins Reformen und Vorschläge dienten so denn dem einen Ziel, der Herausbildung der deutschen Nation und in Preußen sah den den Staat, über den er dies Ziel am ehesten verwirklichen konnte [ 8][B].
Der Staat hat zwei Aufgaben, die Landesverteidigung, die Aufrechterhaltung eines Rechtes, das vor allem den Schutz des einen, vor den Übergriffen eines anderen Menschen sicher zu stellen und einem jeden Menschen die ihm entsprechenden Entfaltungsmöglichkeiten zu garantieren hätte.
Alles andere ist der Nation vorbehalten, d.h. der aus einem freien Austausch der Menschen untereinander hervorgehenden Gesellschaft, wobei das gemeinschaftliche Handeln der Menschen die Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit zur Ausprägung eines, dem Gemeinwohl verpflichteten Charakters befördere [ 9].
Stein leitete vom Sept. 1807 bis Ende Nov. 1808 die preußische Zivilverwaltung. Fünf Tage nach Amtsantritt unterzeichnete er das von Theodor von Schön ausgearbeitete Oktoberedikt. Mit dem Oktoberedit wurde Leibeigenschaft und Erbuntertänigkeit abgeschafft und die freie Berufswahl eingeführt. Alle Einschränkung im Hinblick auf den Kauf und Verkauf adliger Güter wurden beseitigt [10].
Die Umsetzung des Ediktes erfolgte schrittweise ab Febr. 1808.
Von Anbeginn stieß die Agrarreform beim Landadel auf Ablehnung. Die Veröffentlichung des Ediktes wurde durch die Provinzen verzögert.
In der Kurmark regte der Adel die Einberufung einer Ständeversammlung (für den März 1809) an, um Einfluß auf die Umsetzung der Agrarreformen zu gewinnen.
Der preußische Staats- und Innenminister von Dohna drängte denn endlich am 16.09.1810 den zuständigen Oberpräsidenten Sack dazu, das Edikt in der Kurmark, in der Neumark und in Pommern zu publizieren [11].
Karl August von Hardenberg.
Hardenberg schwebte die Schaffung einer Gesellschaft von gleichberechtigten Bürgern vor, d.h. vor allem die Aufhebung der Ständeordnung (sprich Gewerbefreiheit) und die Abschaffung der Leibeigenschaft (tatsächlich gab es eine Unzahl von Abhängigkeitsverhältnissen in denen Bauer/Landarbeiter/Gesinde zum Feudalherren stand). Zur schnellen wirtschaftlichen Entwicklung bedurfte es eines freien Arbeitsmarktes, d.h. der Abschaffung der Leibeigenschaft bzw. der Erbuntertänigkeit, der Abschaffung der Zünfte und der Einführung der Gewerbefreiheit. Die Bauernbefreiung schuf diesen Arbeitsmarkt, sie lieferte der Industrie die überschüssigen Arbeitskräfte und erhöhte die Produktivität auch der Landgüter. Die tatsächlich genutzte, landwirtschaftliche Fläche wuchs bis 1814 um 60%, die Erträge um 40% [12].
Erst nach Schaffung einer Gesellschaft freier Bürger, sollte schrittweise ein System politischer Mitbestimmung geschaffen werden. In diesem Punkt trafen sich Hardenbergs und Humboldts Vorstellungen [13].
Ein freier Bauer war zudem motivierter sein eigenes Hab und Gut, oder auch nur seine Rechte, wie etwa die Preußen jüdischen Glaubens, im Krieg zu verteidigen. Letztlich wurde die Macht des Staates, des Königs durch die Reformen gestärkt und die Basis für eine schnelle wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung gelegt [14][15].
Die, durch das Oktoberedikt genährten, Hoffnungen der Bauernschaft wie die verzögerte Umsetzung führten in Schlesien aber auch in der Kurmark dazu, die Frondienste zu verweigern [16] . Hardenberg sah sich veranlaßt die Husaren aufzubieten.
Für Österreich wie für die Freunde Österreichs am preußischen Hof waren die Dienstverweigerungen ein willkommener Anlaß die preußischen Reformer mit den Jakobiener gleich zu setzten.
Friedrich Wilhelm III. scherte sich 1810 nicht um diese Verleumder, die nicht einmal davor davor zurückschreckten, aus politischem Kalkül, die Königin selbst unter Verdacht zu stellen [17] .
Am 19. Juli 1810 stirbt Königin Louise.
Kurz zuvor antwortete sie dem König auf dessen Frage nach ihren Wünschen:
Dein Glück
die gute Erziehung unserer Kinder
und halte Hardenberg!

Hardenberg nach seiner Berufung zum Staatskanzler am 4. Juni 1810 den Regierungsrat von Potsdam Friedrich von Raumer in die Komission, die die Regulierung der gutsherrlichen-bäuerlichen Verhältnisse festlegen sollte.
Im Juni 1811 ließ König Friedrich Wilhelm III. Seine Regierung wissen:
»Ich weiß, daß der Herr von Hardenberg gerade jetzt ganz außerordentlich beschäftigt ist, und ich will auch dehalb nicht mit einer Ordre drängen, wenn aber die Grundsätze [der Regulierung] gar bald aufgestellt werden könnten, so wäre es mir sehr lieb, damit die Bauern sich beruhigten und wüßten, woran sie wären [18].«
Das von Friedrich von Raumer erarbeitete und am 14.11.1811 erlassene »Edikt die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse betreffend« bewahrte trotz heftiger Kritik des Landadels den Kern des Oktoberediktes. Die Gleichsetzung von Lassiten und Zeitpächtern wurde aufgegeben, von der vollständige Aufrechnung der gegenseitigen Verpflichtungen Dienst hier, Land da wurde abgegangen und an 10 Tagen im Jahr konnten die Gutsherren die Dienste der soweit freien Bauern in Anspruch nehmen [19].
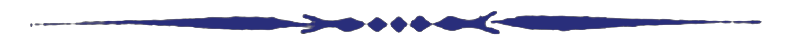
Die Stein-Hardenberg’schen Reformen im Überblick.
Die Staatsreform.
1808/10 Einrichtung einer Kabinettsregierung mit den fünf klassischen Ministerien für Inneres, Finanzen, Auswärtiges, Krieg und Justiz. Den Vorsitz im Ministerrat übt der Staatskanzler aus.
Die städtische Selbstverwaltung [E].
Am 19. November 1808 wurde durch den Freiherrn vom und zum Stein das Prinzip der Selbstverwaltung bei voller Finanzgewalt auf kommunaler Ebene eingeführt. Die Stadtverordnetenversammlung ist für Gemeinderecht und -verwaltung zuständig. Ausführendes Organ bildet der von ihr gewählte Magistrat. Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung wurde jedoch von Besitz und Bildung abhängig gemacht - nicht aber vom Glauben. Soweit waren jüdische Bürger nicht-jüdischen gleichgestellt. Der auf Betreiben Napoleons eingesetzte Stein, wurde am 24.11.1808 auf Betreiben Napoleons abgesetzt [20] [21].
Die Verfassung.
In seiner »Verordnung über die zu bildende Repräsentation des Volks« vom 22. Mai 1815 veranlaßt Friedrich Wilhelm III.
die Heranziehung der Provinzialstände zur Bildung einer Versammlung der Landes- Repräsentanten, deren Aufgaben sich auf die Beratung aller Gegenstände der Gesetzgebung, welche die persönlichen und Eigentumsrechte der Staatsbürger, mit Einschluß der Besteuerung, betreffen, erstrecken sollte. Eine, für den 1. Sept. 1815 einzuberufene, Kommission sollte im Rahmen dieser Vorgaben einen Verfassungsentwurf erarbeiten. Was jedoch nicht geschah [22].
Mehr dazu unter Gedanken zur preußischen Verfassung.
Die Aufhebung der Erbuntertänigkeit, und Einführung der Gewerbefreiheit.
Das Oktoberedikt.
Mit dem Oktoberedikt vom 9.10.1807 des Freiherrn vom und zum Stein, wird jedem preußischen Bürger der Erwerb von Grundbesitz erlaubt. Die Erbuntertänigkeit (eine Form der Leibeigenschaft) wird abgeschafft. Sie beinhaltete bis dahin Abgabepflichten, eine lebenslange uneingeschränkte Dienstpflicht, Gesindezwang der Kinder und die Schollenpflichtigkeit. Zum Heiraten mußte der Erbuntertänige die Erlaubnis des Gutsherren erbitten. Die Bauernstelle konnte nur ein, vom Gutsherrn ausgewählter, Sohn des erbuntertänigen Bauern erben [23][24].
Die Bauern, deren Höfe nicht in Erbpacht betrieben wurden, erhielten am 11. November 1810 ihre Unabhängigkeit.
Die Gewerbefreiheit.
1810 erfolgt die Aufhebund der Zunftordnung. Damit erhält jeder Staatsbürger das Recht auf freie Berufswahl. In Preußen herrscht Gewerbefreiheit.
Grundentlastung.
Am 14.11.1811 wird das »Edikt die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse betreffend« erlassen. In ihm wurde die Auflösung der gegenseitigen Verpflichtungen des Bauern gegenüber dem Gutsherren, wie auch die des Gutsherren gegenüber dem Bauern geregelt. Der Bauer, bislang ohne Eigentumsrecht an dem von ihm bewirtschafteten Bauernhof, konnte, die, für die Inbesitznahme des Grundes, dem Gutsherrn zu leistende Entschädigung, durch das Abtretung eines Teils des Grundbesitzes, finanziell oder durch Kombination beider Formen aufbringen.
Die in Erbpacht vergebenen Höfe hatten 1/3, die nicht in Erbpacht vergebenen 1/2 ihrer Flächen als Entschädigung abzugeben. Der Ausgleich entband den Gutsherrn von seinen Verpflichtungen z.B. Zahlung von Steuern oder Erhaltung der Gebäude [25].
Verbleib der vom Regierungsedikt 1811 betroffenen landwirtschaftlichen Flächen.
Die Einführung einer Selbstverwaltung für Landgemeinden, die Aufhebung der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt scheiterten wie auch die allgemeine Einkommens- und Grundsteuer am Widerstand des Adels [26].
Das Säkularisierungs-Edikt.
Am 30. Oktober 1810 wird das »Edikt über die Einziehung sämmtlicher geistlicher Güter in der Monarchie« erlassen. Alle Klöster, Dom- und andere Stifter, Balleyen und Commenden werden, bei Entschädigung der bisherigen Benutzer und Berechtigten, in Staatsgüter verwandelt.
Die Mittel zur Aufrechterhaltung der, von diesen Einrichtungen geleisteten, sozialen Dienste, werden vom preußischen Staat übernommen.
Die Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung
Wilhelm von Humboldt am 17. Juli 1809: »Auch soll der Staat nicht gerade die Juden zu achten lehren, aber die inhumane und vorurteilsvolle Denkungsart soll er aufheben, die einen Menschen nicht nach seinen eigentümlichen Eigenschaften, sondern nach seiner Abstammung und Religion beurteilt und ihn, gegen allen Begriff von Menschenwürde, nicht wie ein Individium, sondern wie zu einer Masse gehörig und gewisse Eigenschaften gleichsam notwendig mit ihr teilend ansieht [27].«
Die jüdische Bevölkerung erhält die preußische Staatsbürgerschaft und damit das Recht der freien Berufswahl sowie die Pflicht den Wehrdienst abzuleisten. Das Recht auf freie Berufswahl für die jüdischen Staatsbürger wurde in den folgenden Jahren eingeschränkt auf Anstellungen, denen keine leitende Funktion, etwa im Heer und den Bildungsinstituten [28] zukam. Wie so oft in Preußen, bestätigten auch hier die Ausnahmen die Regel.
Die Bildungsreform.
Wilhelm v. Humboldt versuchte als Leiter der Sektion für Kultus und öffentlichen Unterricht eine
Bildungspolitik im Sinne der Aufklärung zu betreiben.
Das Bildungswesens wird verstaatlicht, die allgemeinen Schulpflicht, Abitur und Staatsexamen werden eingeführt und das Unterrichtswesen umgestaltet. Neuhumanistische Gymnasien (gelehrte Schulen) werden eingerichtet. Das dreigliedrige Schulsystem geschaffen und an den Universitäten herrschte das Leitbild freier Bildung und Forschung [29] . Professoren und Studenten begegnen sich auf einer Augenhöhe.
Der Weg zur Universität führte nun über eine 3 jährige Elementarschule dem sich ein 10 jähriges Gymnasium anschloß. Da in der Vergangenheit weniger die geistige Reife der Schüler sondern die Herkunft den Zugang zur Universität ebnete, wurde am 12. Okt. 1812 ein Edict zur Prüfung der zu den Universitäten übergehenden Schülern erlassen. Die für alle Gymnasien verbindliche Regelung sah eine Prüfungskommission aus Direktor, Oberlehrern, Mitgliedern des Schulkurratoriums usw. vor. Die Leitung der Kommission hatte ein Bevollmächtigter der Landesbehörde [30] .
Aus den Prüfungsinhalten ergibt sich der Lehrplan eines neuhumanistischen Gymnasiums [31] . Die Lehrer rekrutieren sich nicht länger aus Theologen, die an den Schulen geparkt, auf eine freiwerdende Pfarrstelle hofften. Mit dem Erlaß des Prüfungsediktes vom 12. Juli 1810 müssen Gymnasiallehrer eine staatliche Prüfung ablegen [32] .
Wichtig waren Humboldt NICHT die praktisch verwertbaren Qualifikationen! Damit unterscheidet er sich grundsätzlich von den retardierten Exemplaren seiner Zunft in der Politik und der Schule heutzutage. Durch eine breite Allgemeinbildung sollten der Schüler die Studierfähigkeit erreichen und als moralisch, geistig gereifter Mensch die Schule verlassen können [C]. Der Lehrplan wurde entrümpelt.
»Gegenstände der Prüfung: Die deutsche, lateinische, griechische und französische Sprache; Religionslehre, Geschichte verbunden mit Geographie, Mathematik.« In Posen wurde zudem die polnische Sprache abgeprüft und in ganz Preußen ab 1825, auf Hegels Wunsch hin, die philosophische Propädeutik [33].
Die Beibehaltung des Unterrichts der alten Sprachen (Latein und Alt-Griechisch) hatte, neben den praktischen Gründen (lateinische, altgriechische Publikationen z.B. in den Bereichen Recht, Medizin, Philosophie) auch das Ziel die Bildung eines sich beim Studium der alten Kulturen notwendigerweise herausbildenden Abstraktionsvermögens zu betreiben; das konkrete Leben im alten Griechenland oder Rom mußte in eine allgemeine Form gebracht bzw. abstrahiert werden, um es mit dem gegenwärtigen vergleichen zu können. Es ging für die Schüler auch um das Erlernen des Lernens [D].
Revolutionär war Schleiermachers Idee die deutsche Sprache unterrichten zu lassen. Das geschah vor allem, um die, gerade in den letzten Jahrzehnten gewonnenen, wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Sprache entsprechend differenziert beschreiben zu können, die auch im Lande gesprochen wird. Die Wissenschaft sollte jedem zugänglich sein. Die Schüler wurden gleichsam zu Boten Athenes, der griechischen Göttin für Kunst und Wissenschaft, das Wissen in die ganze Gesellschaft hineinzutragen, um so einen Beitrag zur Hebung des Bildungsniveaus in Preußen zu leisten [34].
1810 wurde die Berliner Friedrich Wilhelm Universität, die späteren Humboldt Universität [35] gegründet. Wilhelm von Humboldt vereinte Universität, Akademie und andere Forschungeseinrichtungen (Sternwarte, botanischer Garten). Ihm gelang es die bedeutendsten Köpfe Deutschlands (Friedrich August Wolf, Fichte, Schleiermacher, Schlegel, Savigny, Niebuhr, Leopold Ranke…) für diese Universität zu gewinnen. Die Freiheit der Wissenschaft sollte garantiert werden, durch die Überlassung einer staatlichen Domäne. Der Staat beruft die Professoren, um eine Klüngelbildung zu verhindern, womit sein Einfluß auch schon enden sollte.
Humboldt über bildungspolitische Vorgaben des Staates [36] :
»Wer aber für andere so räsoniert [wie der Staat], den hat man, und nicht mit Unrecht, in Verdacht, dass er die Menschheit mißkennt und aus Menschen Maschinen machen will.«
Wilhelm v. Humboldts Vorschläge zur Berliner Universität wurden mit Kabinettsorder des Königs vom 22. September 1809 genehmigt. Einzig die Übertragung einer staatlichen Domäne wurde von der Regierung und dem König nicht gebilligt [37] .
Erwähnt werden muß noch der Maurermeister Carl Friedrich Zelter. Woran keiner der Geistesschaffenden gedacht hatte, Zelter erkannte, daß die Musik ein Zweig der Berliner Akademie zu sein hat. Zelter überzeugte Humboldt und König Friedrich Wilhelm III. ernannte den Maurermeister in seiner Kabinettsorder vom 17. Mai 1809 zum Professor der Musik an der Akademie der Künste [38] .
Die Militärreform.
Am 25.7.1807 beruft Friedrich Wilhelm III. Generalmajor Gerhard von Scharnhorst zum Leiter der Militär-Reorganisationskommission. 1813 bis 1814 erfolgt die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Jeder Staatsbürger muß mit Vollendung des 20. Lebensjahres die Wehrpflicht ableisten. Ausnahmen (Exemtionen) oder Stellvertretungen waren nicht erlaubt [39].