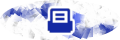Bismarcks Ende.
Sozialgesetzgebung oder Sozialistengesetz - Kaiser oder Kanzler.
Die Zuspitzung von Konflikten als politisches Prinzip.
Des Zauberlehrlings letzte Vorstellung.
Der Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck hatte spätestens mit dem Berliner Kongreß 1878 damit begonnen, die Generallinie der preußischen Politik zu ändern. Ende Januar 1889 erklärte er im Reichstag [ 1]:
»Ich betrachte England als den alten und traditionellen Bundesgenossen, mit dem wir keine Streitigkeiten haben«. und er »wünsche die Fühlung, die wir seit nun doch mindestens 150 Jahren mit England gehabt haben, festzuhalten, auch in den kolonialen Fragen «.
Über sein Kalkül ließe sich nur spekulieren, da ihm letztendlich der junge Kaiser Wilhelm II. in die Parade fuhr.
Damit des Reichskanzlers politisches Gespinst, eines von ihm gelenkten Gespannes mit vier Pferden (eines der Pferde sollte England sein), nicht von der Kaiserin Friedrich (Gattin des Kaisers Friedrich III. und Tochter der englischen Königin Victoria und auch nicht vom Enkel der englischen Königin, Kaiser Wilhelm II. in Unordnung gebracht werden konnte, mußte er Vorsorge betreiben und Bismarck bemühte sich redlich zwischen Wilhelm und seinen Eltern einen Keil zu treiben.
Über seine Zeit im Auswärtigen Amt schrieb Wilhelm [ 2]:
»Meine Eltern standen dem Fürsten Bismarck nicht sehr freundlich gegenüber und verdachten es dem Sohne, in seine Kreise eingetreten zu sein. Man befürchtete Beeinflussung gegen die Eltern, Hyperkonservatismus und wie die Gefahren alle hießen, die von Ohrenbläsern aller Art aus England wie aus „liberalen Kreisen“, welche im Vater ihren Hort erblickten, gegen mich angeführt wurden.
Ich habe mich nie auf solche Dinge eingelassen. Aber die Stellung im Elternhaus ist mir dadurch recht erschwert und manchmal peinlich gestaltet worden. Ich habe wegen meines Arbeitens unter dem Fürsten und meiner oft auf die schwersten Proben gestellten Diskretion für den Kanzler in der Stille recht Schweres zu tragen gehabt, der Fürst fand das anscheinend ganz selbstverständlich«.
Der Fürst andererseits wunderte sich, warum Wilhelm die ‚herzlichen‘ Gefühle des Kanzlers nicht mit den selben Gefühlen beantwortete [ 3].
Bismarcks Bemühungen um eine Allianz mit England, wurde von Salisbury abgelehnt. weil faktisch in England politisch nicht zu vermitteln [ 4]. Diese Aktion hatte das eh schon belastete Verhältnis zu Rußland nicht verbessert, wie es auch dem innenpolitischen Ansehen des Reichskanzlers nicht dienlich war
.Bismarck verlegte sich wieder auf die Pflege der deutsch-russischen Beziehungen, wobei sein Freund Schuwalow in einem Brief nach Petersburg März 1890 bemerkt:
»Ich habe mir ... die Frage gestellt, ob Bismarcks Behauptung, einer der Gründe für seinen Rücktritt sei der Umstand, daß der Kaiser ihn für einen Russophilen hält, nicht bloß eines seiner bekannten Manöver ist, um uns zu einer Demonstration zu veranlassen, die er als Beweis dafür nutzen könnte, daß er allein die Garantie für gute Beziehungenn zwischen unseren Staaten sei [ 5].«
Diese Demonstration blieb aus und so kam es 15. März kam es zum showdown. Bismarck hatte bereits verloren und Wilhelm II. die Nerven angesichts der Pläne Bismarcks zur Abschaffung des Kaiserreiches: „Anfang März legte er dem Ministerrat den Plan für einen Staatsstreich vor: Wilhelm II. sollte den Titel 'deutscher Kaiser' ablegen und danach als König von Preußen zusammen mit den übrigen Monarchen der deutschen Staaten ... ein neues Bündnis eingehen [ 7]“ gut motiviert, die Verlängerung des Rückversicherungsertrages mit Rußland zu verhindern. Der junge Kaiser war wohl präpariert.
Es ging auch um den Umgang mit der Sozialdemokratie. Bismarcks Ansicht [ 8]...
»Sie sind Ratten im Lande und sollten vertilgt werden.«
Der Publizist Maximilian Harden schriebt Ende 1894 über Bismarck:„Seine Durchlaucht [sehen] in dem Staate und der Menschheit ein Aggregat vieler Individuen..., von denen einige gesund, andere gemeinschädlich, das heißt ansteckend infiziert sind. Letztere unschädlich zu machen, wird das pflichtgemäße Bestreben der erteidiger staatlicher Ordnung sein; nötigenfalls ist dies durch Ausschaltung der leitenden Infektionsträger zu erreichen, deren Zahl nicht bedeutend ist [ 9].
Bismarck stand bis zum bitteren Ende an der Seite des Landadels, der Großgrundbesitzer und hielt die Schutzzölle auch dann noch aufrecht, als sie gesamtwirtschaftlich mehr Schaden als Nutzen brachten. Für diese Junker, deren einer Bismarck war, brach eine Welt zusammen, als sie von der Industrie, dem Industrieadel überflügelt und vom Pöbel in den Parlamenten verdrängt wurden. Bis dahin sah der Junker keinen Anlaß daran zu zweifeln, daß er aufgrund seines Blutes, seiner Rasse - wenn man den Adel als solche auffaßt - dem Rest der Menschheit überlegen sei. Diese Überlegenheit wurde infrage gestellt, was den Junkern und Regenten das Leben schwer machte.
Eine Politik des Ausgleichs
Kaiser Wilhelm II. rettet den sozialen Frieden.
Ursächlich für Bismarcks Ende als Kanzler war sein menschenverachtender Starrsinn während eines bis dahin in seinen Ausmaßen nie dagewesenen Streikes, dem Bergarbeiterstreik von 1889. Die Sozialistengesetze liefen aus und Bismarck brauchte ein Argument, seinen Kampf gegen die Sozialdemokraten fortsetzen zu können [10]. Die Eskalation des Bergarbeiterstreikes versprach eine breite Unterstützung für eine Verlängerung bzw. Verschärfung der Sozialistengesetze und schlimmeres.
Schon bei Ausbruch des Streikes im Mai 1889 verschaffte Kaiser Wilhelm II. seiner Seele Luft, indem er bei einem Hoffest in Braunschweig Eulenburg anvertraute [11]:
»Ich habe furchtbare Schwierigkeiten mit dem Fürsten;
Verfassungsänderung und anderes«.
Wilhelm II. rührte das Schicksal der Bergarbeiter zutiefst. Sein Widerstand gegen Bismarck war kein politischer Schachzug sondern eine Herzesangelegenheit. Der junge Kaiser ließ sich v. Hagemeister, dem Oberpräsidenten von Westfalen, Berichte über den Streik zuschicken. Bismarck drohte nun v. Hagemeister ihm sämtliche Unterstützung durch die Regierung zu verwehren, komme es zu Entscheidungen, die ohne das Kabinett getroffen würden [12]. Dessen ungeachtet verfügte der Kaiser über eine Reihe recht kompetenter Berater, die ihn über die aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden hielten und vermochte sich so ein genaues Bild von den Vorgängen zu machen.
Er handele nach dem Motto seines Vorfahren Friedrichs des Großen:
»Je veux être un roi des gueux« und sah es als seine Pflicht an, »für die von der Industrie aufgebrauchten Landeskinder zu sorgen, ihre Kräfte zu schützen und ihre Existenzmöglichkeiten zu verbessern [13]«.
Das war zwar alles andere als ein emanzipatorischer Ansatz aber um Ionen besser wie das, was Bismarck anzubieten hatte, der in der Sozialgesetzgebung die Freiheit des Arbeiters beschnitten sah - sich rund um die Uhr ausbeuten zu lassen. Bismarck jammerte, daß die Industrie bereits 14% Arbeit aufgrund der Sonntagsruhe verlöre und weitere Zugeständnisse an die Arbeiter zu Betriebsschließungen und Massenarbeitslosigkeit führten [14]. Das war schon damals gelogen. Das Gegenteil trat ein, die Wirtschaft des Deutschen Reiches entwickelte sich in einem rasanten Tempo, wohl auch, weil gesunde und zufriedene Arbeiter mehr leisten als kranke und unzufriedene.
Bismarcks Ansatz, die Sozialisten durch Kanonen und Bajonette zu bekämpfen, lehnte der Kaiser ab. Dies ließ sich nicht mit seinem Gewissen und seiner Verantwortung vor Gott vereinbaren [15].
Wilhelm II. ließ den Staatsrat unter seinem Vorsitz zusammentreten und lud zur Beleuchtung der Arbeiterfrage Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein. Unangemeldet platzte Bismarck in diese Versammlung und hielt eine Ansprache, in der er das vom Kaiser ins Werk gesetzte Unternehmen „mit Ironie kritisierte und mißbilligte und seine Mitwirkung versagte [16].“
Dem Staatsrat folgte die Einberufung eines allgemeinen Sozialkongreßes, der ursprünglich in Bern abgehalten werden sollte, auf Anregung des Gesandten Roth jedoch in Berlin tagte und dessen Erkenntnisse in Deutschland Grundlage neuer Gesetze lieferten, das wichtigste unter ihnen bildete das Arbeitsschutzgesetz [17].
Bismarck, Reichskanzler und preußischen Außenminister, hatte seinen Widerstand gegen diese Gesetze energisch bekundet. Er sprach von der „Entmündigung der Väter, denen die Freiheit genommen werde, ihre Kinder auch Sonntags Geld verdienen zu lassen“ und von „Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich, die geschmälert werde“. Das zwang Wilhelm zu einem besonderen Schachzug.
Er bat seinen Onkel Großherzog Friedrich von Baden um Unterstützung. Friedrich gelang es den König von Sachsen und den Großherzog von Baden für das Unternehmen zu gewinnen. Man vereinbarte, daß König Albrecht von Sachsen den Gesetzesantrag im Reichstag einbringen sollte.
Nun drohte Bismarck mit seinem Rücktritt. Kaiser Wilhelm II. glaubte zur Verabschiedung eines, auch von ihm gewünschten, höheren Wehretats auf Bismarcks Hilfe im Reichstag angewiesen zu sein und verzichtete vorerst auf das Arbeitsschutzgesetz.
»Meine Soldaten sind da, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, aber nicht, um den Zechenbesitzern hohe Profite zu sichern« [18]
Am 25. Januar 1890 tagte der Kronrat. Der Kaiser schilderte das soziale Elend der Arbeiter in drastischen Worten und sprach von skrupellosen Kapitalisten die die Arbeiter wie Zitronen ausgepreßten. Bismarck blieb stur. Die Minister fügten sich, von Ausnahmen abgesehen, dem Kanzler.
Hierzu bemerkte Wilhelm II. gegenüber seinem Onkel: »Die Minister sind ja nicht meine Minister, sie sind die Minister des Fürsten Bismarck [19]«.
In der Hoffnung der Kaiser rücke von seinen eigenen Plänen ab, ließ Bismarck zwei stümperhafte Entwürfe zum Arbeitsschutzgesetz ausarbeiten, ohne sie selbst abzuzeichnen. Würde ihm der Kaiser auf den Leim gegangen sein, der Kanzler hätte den Entwurf zum Schaden des Kaisers verwendet [20].
Am 20. Februar 1890 fanden Reichstagswahlen statt. Die Parteien auf die sich Bismarck bislang stützen konnte, verloren ihre Mehrheit. Linksliberale, Katholiken und Sozialdemokraten gewannen die Mehrheit [21].
Zur innenpolitischen Machtverschiebung kamen außenpolitische Schwierigkeiten hinzu.
Es waren 50% der russischen Staatsanleihen in Deutschland platziert. Als Gerson Bleichröder eine Umschuldung aushandelte, brach ein Sturm der Entrüstung los, da ein schneller geringerer Profit durch einen späteren höheren ersetzt worden wäre.
Eine antisemetistische Stimmung wurde geschürt (Bleichröder war Jude) um Bismarck und „seinen“ Bankier aus dem Weg zu räumen. Der Jude würde den Russen mit deutschem Geld versorgen, was dieser zu einem Krieg gegen Deutschland verwenden würde. Daß der deutsche Jude Bleichröder mit dieser Umschuldung, dem an der Aktion ebenfalls beteiligten französischen Juden Rothschild einen großen Teil der Provision abgehandelt hatte ist Nebensache.
Ausgerechnet mit der antisemitischen Hetze gegen Bleichröder und ein gewisser Graf v. Waldersee hetzte mit suchte man Bismarck zu Fall zu bringen. Das bedeutete das Ende für die Umschuldung. Die Russen wickelten ihre Geldgeschäfte in Paris ab. Die Weichen hierfür hatte Rothschild bereits im Vorfeld gestellt als er mit dem Kaiser von Rußland Kontakt aufgenommen hatte [23].
Um den Brechreiz ausufern zu lassen: Die von Bleichröder vermittelte geheime Zusammenkunft Bismarcks mit dem Zentrumspolitiker Windhorst wurde von denjenigen gegen Bismarck ausgespielt, die wenig später die Volksschulen Preußens gemäß den Wünschen des Zentrums dem Einfluß der katholischen Kirche erneut öffnen wollten [24].
Aufgrund dieses konspirativen Vorgehens zitierte am 15. März 1890 9:30 Uhr der Kaiser Bismarck zu sich und wies ihn zurecht.
Bismarck provozierte den Kaiser und das in einer Weise, die diesen instinktiv nach dem Degen greifen ließ. Der russische Kaiser Alexander III. hatte Wilhelm II. in einem Schreiben attestiert, schlecht erzogen worden zu sein. Bismarck verwendete diesen Brief, um deutlich zu machen, weshalb er unverzichtbar zur Erhaltung des Friedens sei [25] und sprach Kaiser Wilhelm II. zudem ein Recht ab, das er einst Wilhelm I. bereitwillig zugebilligt hatte: Das Recht des preußischen Königs auf die letzte Entscheidung.
Am 18. März 1890 reichte Otto Fürst von Bismarck sein Rücktrittsgesuch ein. Bismarcks Entlassung war denn auch - Sozialistengesetze hin und Sozialgesetzgebung her - der Außenpolitik zu verdanken. Am 17. März traf Bismarck den russischen Botschafter Graf Schuwalow, der Vollmacht zur Vereinbarung des Rückersicherungsertrages hatte [26]. Das durfte nicht geschehen [27] [28] . Caprivi saß auf Bismarcks Stuhl, noch bevor dieser am 29. März Berlin verlassen hatte [29].
Bismarcks Entlassung erlaubte es in der Folgezeit eine Reihe zukunftsweisender Gesetze zu verabschieden, z.B. das Gesetz über Gewerbegerichte, das am 29. Juli 1890 in Kraft trat, die Novellierung der Reichsgewerbeordnung im Juni 1891, das nach den kaiserlichen Vorgaben am 24. Juni 1892 erlassene preußische Berggesetz. Wilhelm II. berief Johannes von Miquel zum neuen Finanzminister, dem es gelingen sollte ein modernes Steuersystem durchzusetzen. In Preußen wurde eine neue Landgemeindeordnung verabschiedet und um 1900 das Bürgerlichen Gesetzbuch geschaffen. Die somit geschaffene Rechtssicherheit und soziale Sicherung sorgten dafür daß sich Deutschland zu einem der führenden Länder dieser Erde entwickeln konnte [30].
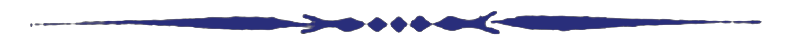
Doch es drohte Ungemach, was Sir Austen Chamberlain schon 1887 wußte [31]: Deutschland läßt sich in einen auf dem Balkan inszenierten Krieg hineinziehen. Rußland wurde zum Feind und Österreich zum Freund der schlimmster Art.
Man hatte Bismarck gestürzt. Es rückte der Kaiser in die Schußlinie.