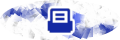Zum Aufbau der kaiserlichen Flotte.
Die Vorgeschichte des Flottenbaus.
Zu Beginn des 19. Jhdts. standen sich millionen und abermillionen Menschen im Feld gegenüber, den Kontinent zu verwüsten und sich gegenseitig zu töten. Abgesehen von dem einen oder anderen englischen General war an den Gefechten kaum ein Engländer beteiligt.
England besaß das Monopol auf den Handel zur See, importierte Rohstoffe, die es, in der sich, dank der verfügbaren Arbeitskräfte, schnell entwickelnden Industrie, veredelte und auf dem Kontinent verkaufte. Europa wurde durch die napoleonischen Kriege zum Schuldner Großbritanniens und hatte seine Mühen unter diesen Bedingungen eine eigene Industrie aufzubauen.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts mußten millionen Deutsche auswandern, weil das Land sie nicht mehr ernähren konnte. Eine vorbildliche Bildungspolitik und die, in Handwerk und in anderem Gewerbe übliche, gute Ausbildung der Arbeiter, mündeten in einem rasanten Wirtschaftsaufschwung. Der Emigration wurde so ein Ende gesetzt, doch das anhaltend hohe Bevölkerungswachstums verurteilte das Land zu weiteren Anstrengungen.
Tirpitz: »Dem Wachstum unsrer Industrie verdankten wir das Wachstum unsrer physischen und materiellen Stärke.
Wir nahmen jährlich fast um eine Million Menschen zu, das heißt gewannen auf dem unverändert engen Spielraum der heimischen Scholle alljährlich etwas, das dem Zuwachs einer Provinz gleichkam, und dies alles beruhte auf der Aufrechterhaltung unsres Ausfuhrhandels, der mangels eigener Seemacht ausschließlich vom Belieben der Fremden, d.h. der Konkurrenten abhing. Wir mußten nach Bismarck „entweder Waren ausführen oder Menschen“…[ 1].«
Der Welthandel, von dem der Wohlstand der Bewohner des Deutschen Reiches abhing fand jedoch zu 70% auf der See statt und war in hohem Maße von den Einrichtungen, Überseehäfen, Stichbahnen, Docks, Bunkerstationen und Transportkapazitäten der Engländer abhängig.
Die Kriegsmarine war vor 1890 nicht einmal in der Lage, die deutschen Fischer in der Nordsee vor Übergriffen der ausländischen Konkurrenz zu schützen, die, ohne ein Risiko eingehen zu müssen, die Netze der, unter deutscher Flagge segelnden, Kutter kappten.
Bernhard Fürst von Bülow: »Eine Kriegsflotte mußte der Armee zur Seite treten, damit wir unserer nationalen Arbeit und ihrer Früchte froh werden konnten... «
Doch der Gedanke ein kontinentaler Staat könne, ähnlich wie zu Land üblich, seine friedliche Existenz auch auf See durch Waffen bewahren wollen, war England, aus verständlichen Gründen, fremd.
»Die Flotte sollte gebaut werden unter Behauptung unserer Stellung auf dem Kontinent, ohne Zusammenstoß mit England,... [ 2].«
Was, wie sich erweisen sollte nicht gelang.
Kaiser Wilhelm II. schrieb in seinen Erinnerungen [ 3]:
»Er [Tirpitz] war bei seinen ersten Vorträgen, die den Grund zum ersten Flottengesetz legten, mit mir vollkommen darüber im reinen, daß der Flottenbau auf die bisherige Weise im Reichstage nicht zur Annahme zu bringen sei. … Deshalb war es nötig, daß die in rebus navalibus noch ziemlich unkundigen Reichsboten erst einmal mit den Einzelheiten der großen Aufgabe vertraut gemacht wurden. Ferner galt es eine allgemeine Bewegung im Volke auszulösen, das noch gleichgültige „große Publikum“ für die Marine zu interessieren und zu erwärmen, damit aus dem Volke selbst heraus ein Druck auf die Abgeordneten erfolge. Dazu war eine gut organisierte und geleitete Presse sowie durch bedeutende Männer der Wissenschaft von den Universitäten und Technischen Hochschulen erforderlich .«
Als ein Beispiel ließe sich der Wirtschaftshistoriker und Flottenbefürworter Gustav Schmoller anführen, der für den Bau der Flotte warb, jedoch nicht ohne folgendes zu betonen:
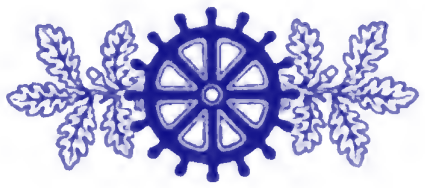
»Wir sind ein friedliches Volk, denken an keine Eroberungen; unsere Nachbarn sind dicht bevölkerte Länder, mit denen wir friedlichen Verkehr haben wollen, nicht mehr; die auch, wenn uns je noch das eine oder andere zufiele, uns nicht Raum für Kolonisation, für neue Städte und Dörfer bieten würden,... [ 4].«
Aus der damaligen Perspektive war also ein Krieg ungeeignet das Problem des Landes zu beseitigen, da von ihm eine Linderung des Bevölkerungsddruckes nicht erwartet werden konnte.
Kaiser und Regierung waren darauf bedacht, daß das Werben für die Flotte nicht in einen plumpen Nationalismus umschlug. Fürst v. Bülow: »Das patriotische Empfinden sollte aber auch nicht überschäumend und in nicht wieder gut zu machender Weise unsere Beziehungen zu England stören...;[ 5].«
Wen zu fürchten die Engländer hätten, hing nicht von der deutschen Politik ab, sondern von der englischen Presse. Sir Edward Grey sagte am 20. November 1908 in Scarborough: „daß die Schwierigkeiten der auswärtigen Politik von der Erfindungskraft der Presse der verschiedenen Länder abhingen, welche den gegenseitigen Regierungen immer andere Beweggründe unterschöben."
Der englische Außenminister Grey wurde von der antideutschen Fraktion im Foreign Office gezielt mit bedrohlichen Nachrichten aus Deutschland versorgt [ 6.0].
Also wandte sich Kaiser Wilhelm II. in seinem Brief vom 14. Februar 1909 an den Ersten Lord der brit. Admiralität, Lord Tweedmouth, darum bemüht im Vorfeld einer Flottennovelle dem Wettrüsten zur See vorzubeugen.
Propaganda: Aus gewöhnlich gut informierten Kreisen (Ex-Oberst Charles Repington) wurde kolportiert und von der Presse (George E. Buckle von der Times) aufgegriffen, dass der Kaiser über Lord Tweedmouth Einfluß auf die englische Flottenvorlage nehmen wollte.
Buckle hatte den Eton-Absolvent Repington, nachdem der mit der Frau eines anderen Offiziers wegen ‚ungebührlichen Verhaltens’ aufgefallen und aus der Armee entlassen worden war, bei der Times angestellt.
Sachverhalt: Der Brief wurde nach Kriegsbeginn veröffentlicht.
In ihm bezeichnete es der Deutsche Kaiser als »blödsinnig und unwahr«, daß die beabsichtigte, deutsche Flotte die britische Seeherrschaft herausforderte. Es sei »sehr verletzend für die Deutschen, zu merken, daß ihr Vaterland fortgesetzt als die einzige Bedrohung und Gefahr für England durch die ganze Presse, selbst der sich befehenden Parteien, betrachtet wurde, besonders wenn man bedenkt, dass alle anderen Länder ihre Flotte ebenso ausbauen, und daß bereits größere Flotten vorhanden seien, als die deutsche.«
Kaiser Wilhelm II. befürchtete, daß aus einer anti-deutschen Berichterstattung ein bleibendes Unheil entstehen könnte und verwies auf die abzusehenden Forderungen des deutschen Flottenverbandes [ 7].
Um die Hochrüstung der britischen Flotte im Parlament durchzusetzen scheute, die, sich damals im Besitz Viscount Northcliffes befindliche, Times, auch vor Lügen nicht zurück, wie aus den Aufzeichnungen des ebenfalls für die Hochrüstung eintretende Sir Austen Chamberlain hervorgeht. Er notierte am 27.02.1909: „Sehr ernste Berichte über die Flotte gehen um. Du wirst gesehen haben, daß die ,Times' und andere Zeitungen annehmen, und ich fürchte, mit Recht, daß die deutsche Regierung ihr neues Bauprogramm tatsächlich schneller, als gesetzlich festgelegt, vorangetrieben hat und sich in den neuesten Schiffstypen stark einer Übermacht über uns um die Jahre 1911-12 nähert, wenn sie sie nicht bereits erreicht hat [ 8].“
Am 9. März erklärte Lord Rosebery: „Kein Deutscher außerhalb einer Irrenanstalt würde geträumt haben, daß solcher Brief irgendeinen Einfluß auf die englische Rüstung haben könne“ und verurteilte das Gebaren der Presse selbst nichtige Anläße heranzuziehen, um böses Blut zwischen England und Deutschland zu machen [ 9].
Am 5.Mai schrieb Lord Fisher an Lord Esher, daß die englische Marine noch nie so stark gewesen sei, wie derzeit und es mit allen Marinen der Welt zusammengenommen aufnehmen könne [10].
Das Theater sollte den für 1909 geplanten Krieg gegen Deutschland und Österreich-Ungarn vorbereiten. Die Annexion Bosniens durch Österreich sollte für diesen Krieg als Rechtfertigung genutzt werden. Also mußten die Menschen auf den Krieg eingestimmt werden. Da sich Frankreich, gemäß Aussage des — im russischen Generalstab tätigen, Adjutanten des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch — Fürsten Tundutows selbst noch nicht stark genug wähnte, möglicherweise aber auch, weil es um den Beistand Englands fürchtete [11], mit dem Frankreich zu dieser Zeit in einem Handelsstreit lag [12], fiel dieser Krieg aus. Zuviel Hetze gegen Deutschland, hätten es zu gesteigerten Rüstungsanstrengungen verleiten können.
Propaganda ist zielgerichteter Wahnsinn.
Das Ziel: Verteidigung des britischen Imperiums.
Die Methode: Spaltung und Schwächung der Kontinentalmächte.
Mackinder arbeitete an seiner Herzland-Theorie („The Geographical Pivot of History erschien 1904), und „befürchtete“, daß das Deutsche Reich, aufgrund der geopolitischen Lage und der effizienten Wirtschaft, in die Rolle der Weltmacht hineinwachse [13].
Das zu verhindern verbündete sich Großbritannien mit Frankreich und Rußland. Die französisch-russische Militärkonvention wurde 1894 abgeschlossen, d.h. noch bevor das Deutsche Reich über eine nennenswerte Seestreitmacht verfügte. Die Entente Cordiale wurde 1904 gegründet, das Flottengesetz zum Bau von Großkampfschiffen wurde 1906 dem Reichstag vorgelegt.
Fürst v. Bülow: »Wir sind nicht in die Weltpolitik hineingesprungen, wir sind in unsere weltpolitischen Aufgaben hineingewachsen, und wir haben nicht die alte europäische Politik Preußen-Deutschlands gegen die neue Weltpolitik ausgetauscht,… [14].«
Die deutsche Politik war friedlich, erfolgreich und bedrohte Englands Vormachtstellung.
Stosch.
Die Flotte des Norddeutschen Bundes verfügte 1866 über 25 Schiffe (Ruderboote ausgenommen). Die drei größten waren die Panzerkreuzer Arminus 1829 t, die Prinz Adalbert 1829 t und die König Wilhelm 10 760 t.
1872 wurde Albrecht v. Stosch zum ersten Chef der kaiserlichen (reichsunmittelbaren) Admiralität. Stosch reorganisierte die Marine, legte ein Flottenbauprogramm vor, setzte es durch, daß die Schiffe der kaiserlichen Marine in deutschen Werften gebaut wurden und die Marine Überseedienste verrichten konnte. Er sorgte für eine gründliche Gefechtsausbildung, für ein gestuftes Lehrgangs- und Schulsystem zeitgemäße Lehrmethoden und eine darauf basierende Personalgliederung [15].
Admiral Stosch sorgte für die Gründung der Marineakademie, des Meteorologischen Amtes (der Seewarte) und des Hydrographischen Amtes.
In einer Denkschrift von 1873 erklärte Stosch: »Die Offensivkraft in einem großen Kriege kann und muß Deutschland seiner Landarmee überlassen [16].« Für ihn war die Flotte gleichbedeutend mit Küstenschutz.
Sein Flottengründungsprogramm sah bis 1882 den Bau von
- 8 Panzerfregatten,
- 6 Panzerkorvetten,
- 7 Monitoren (kleine mit schweren Geschützen bewaffnete Schiffe für küstennahen Einsatz bzw. den Einsatz in Binnengewässern,
- 2 Panzerbatterien,
- 20 Korvetten,
- 6 Avisos (kleine Kreuzer mit z. T. eingeschränkter Hochseetauglichkeit),
- 18 Kanonenbooten,
- 2 Artillerieschulschiffen,
- 3 Briggs (Zweimastsegler, dienten als Schulschiffe) und
- 28 Torpedobooten vor [17].
Infolge der Krise 1877 stellte Reichskanzler Bismarck Admiral Stosch kalt, da ihm dessen Nähe zum liberalen Kronprinzen Friedrich Wilhelm verdächtig erschien. Bismarck befürchtete gestürzt zu werden; er vermutete, daß man beabsichtigte ihn »durch ein Cabinet Gladstone zu ersetzen [18]«.
Im Klartext: Er fürchtete, daß der, mit der englischen Prinzessin Victoria verheiratete, Kronprinz, der spätere Kaiser Friedrich, dem englischen Einfluß erliegen könne.
Caprivi.
Georg Leo Graf von Caprivi löste 1883 Stosch an der Spitze der Marine ab. Die von Stosch bereits begonnene Entwicklung von Torpedobooten wurde durch Caprivi fortgesetzt. Nachdem der spätere Großadmiral Tirpitz die technische Entwicklung der Torpedos geleitet hatte, übertrug ihm Caprivi die Aufgabe, für die Herstellung geeigneter Torpedoboote zu sorgen [19].
Mit Caprivi erhielt die Flotte eine strategische Ausrichtung deren Notwendigkeit er leichthin mit den von ihm Jahr für Jahr wiederholten Worten betonte:
»Nächstes Frühjahr haben wir den Zweifrontenkrieg [20].«
Die Aufgabe der Kriegsmarine mußte es also sein, die Vereinigung der russischen mit der Flotte Frankreichs zu verhindern.
Gegenüber England strebte Caprivi freundschaftliche Beziehungen an. Den Rückversicherungsvertrag mit Rußland ließ der 1890 von Kaiser Wilhelm II. zum Reichskanzler ernannte Caprivi auslaufen, um eine Annäherung an England nicht zu gefährden. Der am 1. Juli 1890 geschlossene Helgoland-Sansibar-Vertrag bot Cecil Rhodes die Möglichkeit, das britischen Kolonialreich bzw. die Herrschaft der „East Africa Company“ auf Sansibar aber auch auf Uganda (1893) und Kenia (1895) auszudehnen [21].
Deutschland erhielt im Gegenzug – neben kleineren Gebieten in Afrika – Helgoland. Damit wollte Caprivi die Nutzung Helgolands als französischen Ankerpunkt verhindern.
Stosch und Tirpitz gingen jedoch davon aus, im Kriegsfalle nicht mit einer englischen Neutralität rechnen zu können und erwogen Helgoland zu einem Hochseehafen für die deutsche Marine auszubauen, um einen küstennahen Blockadegürtel der Engländer zu verhindern [22].
Der Helgoland-Sansibar-Vertrag war Anlaß – wenn auch nicht Ursache – zur Gründung des Alldeutschen Verbandes. Gründungsväter waren Emil Kirdorf, die treibende Kraft beim Aufbau des deutschen Kohle- und Stahlsyndikates und Alfred Hugenberg der Propagandist der Kohle- und Stahlindustrie wie auch dessen Pinup-Kolonialist Carl Peters. Ziel des Alldeutschen Verbandes war es, eine Stimmung zu entfachen, die dem Absatz von Erzeugnisse der Schwerindustrie (z.B. Schiffe und Kanonen) förderlich war [23].
Kaiser Wilhelm II.
Der allem Neuen aufgeschlossene, im Umgang selbst mit einer Jolle geübte Kaiser Wilhelm II. nutzte die Gelegenheit, sich der allgemeinen, jeden Fortschritt blockierenden Bismarck-Nostalgie zu entledigen, indem er den Bau der Flotte mit seinem Namen bzw. seiner Person verband.
Kurz nach der Thronbesteigung verfügte Kaiser Wilhelm II. die Reorganisation der Marine. Die Marine erhielt ein eigenes Oberkommando. Mit dem Reichsmarineamt (RMA) schuf er gleichsam ein Marineministerium [24]. Hinzu kam das vom Kaiser selbst geleitete Marinekabinett [25].
Zunächst ging es um die strategische Ausrichtung der Flotte, d.h. darum, viele unterschiedliche Vorstellungen miteinander in Einklang zu bringen.
Die Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit lag aber im Argen. Kaiser Wilhelm II. nach einer der vielen Auseinandersetzungen [26]:
»Jetzt habe ich euch zugehört, wie ihr stundenlang räsoniert habt nach dem Prinzip, die Schweinerei muß aufhören, und doch hat kein einziger einen wirklich positiven Vorschlag gemacht.«
Des Kaisers Herz mochte zwar angesichts der vielen Flottenmanöver, denen er beiwohnte, höher geschlagen haben, vergessen werden sollte dabei nicht, daß diese Manöver vor allem dazu dienten, die Flotte als Verteidigungssystem weiterzuentwickeln und erfolgversprechende Strategien und Taktiken durchzuspielen.
Bevorzugte man anfangs ein Durchbruchsgefecht mit nebeneinander gestellten Schiffen, um idealerweise im Nahkampf die Schlachtordnung des Gegners aufzulösen, wobei den Torpedobooten eine wichtige Rolle zugekommen wäre, führte die Entwicklung weitreichender Artillerie dazu, in Kiellinie hintereinander fahrende Schiffe ihre Breitseiten auf den Gegner abfeuern zu lassen. Anstelle des Torpedobootes bedurfte es neuer Linienschiffe [27].
Caprivi wurde von Graf Mons ersetzt, Mons der bereits auf die Linienschiffe setzte wurde von Admiral Hollmann ersetzt und der resignierte, nachdem seine Bemühungen, die Mittel zum Aufbau der Flotte vom preußischen Landtag bewilligt zu bekommen, scheiterten [28].
1897 wurde mit Tsingtau ein deutscher Marinestützpunkt in China errichtet, der wie allen Verantwortlichen klar war, der Marine nur in Friedenszeiten und zwar zur Sicherung des deutschen Überseehandels nützlich sein konnte. Die erfolgreiche Besetzung und Anpachtung von Tsingtau diente den Treibern eines deutschen Imperialismus als Beispiel, über das sie ihre Ziele in Land umzusetzen gedachten.
1897 wurde Alfred von Tirpitz an die Spitze des Reichsmarineamts berufen [29].
1899 übernahm Kaiser Wilhelm II. den Oberbefehl der Flotte. Das gefiel weder Tirpitz, noch der Lobby, die sich für den Bau großer Kampfschiffe stark machte.
Tirpitz.
Trotz eigener Vorbehalte gegen die Torpedoboote sorgte Tirpitz dafür, daß die Pläne Caprivis soweit möglich umgesetzt wurden. Das war die Kröte, die Kaiser Wilhelm II. Tirpitz zu schlucken gab. In einem von ihm unter Pseudonym in der „Marine-Rundschau“ Januar 1904 veröffentlichen Artikel maß der Deutsche Kaiser den leichten, schnellen und billigen Schiffen, die er mit den Linienschiffen verglich, eine größere Bedeutung bei [30].
Erstmals wurde mit dem Torpedoboot ein Boot entwickelt, nachdem die seinen Einsatz betreffende Strategie bestimmt worden war. Die technische Entwicklung lag nicht mehr in der alleinigen Verantwortung der Werften, sondern bei der Marine. Zur technischen Reife gelangten die Boote aber erst im Verlauf des Krieges 1914/18. In den Folgejahren wandelte sich das Torpedoboot zum Schnellboot, was den eigentlichen Wert dieser Bootsgattung zur Geltung brachte [31].
Gekoppelt an die Entwicklung der Torpedoboote war die Weiterentwicklung des Torpedos zu einer auch auf größerer Distanz hinweg treffsicheren Waffe, ohne die, die erst später gebauten, U-Boote erfolglos geblieben wären. Es waren die Torpedoboote im Krieg 1914/1918, die die britische Seemacht bei den Schlachten in der Nordsee bzw. bei der Verteidigung der U-Bootstützpunkte in Flandern in die Schranken wies. Der Versailler Vertrag selbst dokumentiert dies, indem die fortan Deutschland erlaubte Anzahl der Torpedoboote von einigen hundert auf acht Boote festgesetzt wurde.
Unter Tirpitz wurde 1897 eine Flottenvorlage erarbeitet, deren Ziel durch den Risikogedanken vorgegeben war: Die Flotte sollte so stark werden, daß sie einem Angreifer Verluste in einer Höhe beizubringen vermochte, die ihn von weiteren Angriffen abhalten sollte. Die Mobilisierung der Öffentlichkeit für die Flottenpläne bewog den Reichstag die zur Umsetzung erforderlichen Mittel bereitzustellen.
Die Flottenvorlage entsprach in ihrem Kern noch dem Konzept der Ausfallflotte wie sie Stosch vorschwebte, ließ aber die Weiterentwicklung zu der von Tirpitz angestrebten Schlachtflotte erkennen, die zunächst 17 Linienschiffe, 8 Küstenpanzerschiffe aus 6 Großen und 10 Kleinen Kreuzern umfassen sollte [32]. Der dem Parlament vorgelegte Gesetzesentwurf versprach in den veranschlagten sechs Jahren ohne die Erhebung zusätzlicher Steuern auskommen zu können [33]. Preissteigerungen und der Wunsch die Baurate von drei Schiffen jährlich aufrecht zu erhalten machten aber die Vorlage eines zweiten Gesetzentwurfs notwendig [34] [35].
Die Kaiserlichen Marine ging von einem übermächtigen Gegner aus, was der Entwicklung strategischer Überlegungen enge Grenzen zog.
Die Flotte als Ganzes war dem erwarteten Gegner unterlegen. Es bestand nie eine Absicht, daran etwas zu ändern. Der Schwerpunkt wurde deshalb auf das Zusammenspiel von Taktik und Technik, auf die Ausbildung der Mannschaften und die Befähigung der Befehlshaber während Schlachten unabhängig von Direktiven des Flottenkommandos handeln zu können, gelegt [36].
Dem Auf- und Ausbau der Kaiserlichen Marine lag jeweils ein längerfristiges Konzept zugrunde, um den gefürchteten jährlichen Haushaltsdebatten möglichst lange aus dem Weg gehen zu können, d.h. wann welches Schiff auf Kiel gelegt wurde, war weitgehend von der Marinepolitik des Auslandes entkoppelt [37].
Mit dem Flottengesetz von 1900 rückte die Flotte von der reinen Küsteverteidigung ab. Auf die Küstenpanzerschiffe wird verzichtet. Anstelle der bisher geplanten 17 Linienschiffe für die heimische Schlachtflotte wurden 34 Linienschiffe zur Bildung von vier Geschwadern, zwei „aktive“ (d.h. permanent in Dienst) und zwei in Reserve, gefordert. Hinzu kamen die für den Auslandsdienst nötigen großen und kleinen Kreuzer Die Torpedobootsdivisionen waren vom neuen Gesetz nicht betroffen [38].
Die deutschen Flottenpläne lösten in England eine heftige Kampagnie aus. Maltzahn wunderte sich, daß man in England die deutsche Flottenrüstung nicht „der natürlichen Entwickelung der wirtschaftlichen Verhältnisse“ zuschrieb, „sondern in einer Nervosität, die schwer verständlich ist für ein Land, das sich seiner Stärke bewußt ist, … auf Angriffspläne Deutschlands“ schloß [39].
Während unter der Bevölkerung Großbritanniens die Angst geschürt wird herrscht in der Admiralität der Wahn omnipotenter Überheblichkeit. Lord Fisher, Erster Seelord Seiner Majestät, in seinen Memoiren [*]:
»Was sind die wahren Fakten? Wie es in einem offiziellen Dokument der Admiralität vom 22. August 1907 heißt: „Wir haben 123 Zerstörer und 40 Unterseeboote. Die Deutschen haben 48 Zerstörer und 1 U-Boot.“
Alle unsere Zerstörer und U-Boote sind absolut leistungsfähig und sofort kampfbereit und vollständig bemannt, mit Ausnahme eines Teils der Zerstörer, die vier Fünftel ihrer Besatzung an Bord haben. Das reicht für den sofortigen Einsatz aus und kann in weniger als einer Stunde auf volle Besatzung aufgestockt werden. Und sie alle werden ständig trainiert.
Eine weitere Information habe ich noch zu geben: Admiral Tirpitz, der deutsche Marineminister, hat soeben in einem geheimen offiziellen Dokument erklärt, dass die englische Marine jetzt viermal stärker ist als die deutsche Marine. Ja, das stimmt, und wir werden die englische Marine auf dieser Stärke halten, während zehn "Dreadnoughts" gebaut werden und gebaut werden, und nicht eine einzige deutsche "Dreadnought" im letzten Mai in Dienst gestellt wurde.Aber wir wollen das alles nicht vor der ganzen Welt zur Schau stellen.«
Nicht der Aufbau einer deutschen Marine beschäftigte die feixenden Herren des britischen Empire, die ihrem Irrsinn mit der Heartland-Theorie eine Berechtigung zimmerten, nach der eine (nach Rußlands Abkehr von Deutschland wenig wahrscheinliche) deutsche Dominanz in Eurasien [40] das britische Weltreich erschüttern werde.
Großkampfschiffe bzw. „Dreadnoughts“.
In Deutschland warb man für den Bau der Flotte, in England versetzte man die Menschen in Angst und Schrecken vor einer deutschen Invasion, die Aufwendung horender Summen, zum Umstieg auf eine neue Schiffsgeneration, vor dem Wähler zu rechtfertigen.
Am 7. Februar 1905 schrieb der belgische Botschafter in London an seinen Außenminister:
»Die Feindseligkeit der englischen Öffentlichkeit gegenüber Deutschland beruht offenbar auf Eifersucht und Furcht – Eifersucht angesichts der wirtschaftlichen und kommerziellen Pläne Deutschlands, Furcht davor, dass die deutsche Flotte ihnen eines Tages die Oberhoheit auf den Meeren streitig machen könnte… Diese geistige Haltung wird von der englischen Presse angefacht, ungeachtet jedweder internationalen Komplikationen… ein unkontrollierter Hurrapatriotismus verbreitet sich im englischen Volk, und die Zeitungen vergiften Schritt um Schritt die öffentliche Meinung [41]«.
Im selben Jahr erklärte der Zivillord der Admiralität Lee, daß die britische Flotte gegebenenfalls den ersten Schlag führen werde, noch ehe man auf der anderen Seite der Nordsee Zeit gehabt hätte, die Kriegserklärung in der Zeitung zu lesen [42].
Ebenfalls 1905 begann man in England mit dem Bau von Schiffen der „Dreadnought-Klasse“. Die britische Marine begann ihre Schiffe in der Nordsee zu konzentrieren und errichtete an der Ostküste Großbritanniens neue Stützpunkte, um die erhöhte Präsenz in der Nordsee auf Dauer aufrechterhalten zu können.
1906 wurde im deutschen Reichstag über eine neue Flottennovelle abgestimmt. Dank der feindlichen Haltung Großbritanniens wurde diese Gesetzesvorlage mit großer Mehrheit angenommen. Das galt für die im Jahre 1900 noch abgelehnte Forderung von 6 neuen Großen Kreuzern, wie auch für den Bau weiterer Torpedoboote und für die Entwicklung von Unterseebooten, über die damals die französische Marine wie auch die britische seit längerer Zeit verfügt hatte [43].
Weitere Gesetzesvorlagen in der Folgejahren sorgten für die Einführung deutscher Großkampfschiffe, sei es als als Ersatz für die veralteten Schiffstypen oder im Rahmen des 1900 festgelegten Tempos, in dem man die deutsche Marine aufzubauen beabsichtigte. Im Durchschnitt sollten zwischen 1908 bis 1917 pro Jahr drei Schiffe gebaut werden.
Fanden die britischen Imperialisten in der Wirklichkeit kein Argument, die Plünderung der Steuerzahler zur Finanzierung ihrer Hochrüstungspläne zu rechtfertigen, so bedienten sie sich der Phantasie. Es wurde Deutschland unterstellt, für seine Flotte größere, als die ausgewiesene Summe aufzuwenden.
Kein geringerer als der Erste Lord der Admiralität, Winston Churchill korrigierte dies später, in seiner Rede vom 9. November 1911, in der er »sich freute bezeugen zu können, daß die Erklärungen des deutschen Ministers über den Bauplan durch die Ereignisse genau bestätigt werden [44]«.
Den Erinnerungen Sir Austen Chamberlains vom 5. März 1907 nach, hat England durch das deutsche Flottenprogramm nichts zu befürchten [45]:
Heute verbrachten wir den Tag mit den Flottenvoranschlägen. Das einzig Bemerkenswerte ist die Campbell-Bannerman abgewonnene Erklärung über den Zweimächtestand, wie wir ihn immer verstanden haben, das heißt als unsere Sicherung durch ein Übergewicht über beliebige zwei Mächte zu allen Zeiten. Wir haben ohne Zweifel gerade jetzt ein gutes Übergewicht, weil andere Mächte ihre Bauvorhaben unterbrochen haben, um zu sehen, wie die „Fürchtenichts“ (Dreadnought) ausfallen werden, und weil sie noch keine Entscheidung darüber gefällt haben, wie sie diesen Schiffen begegnen sollen, das heißt mit welcher Schiffsbauart.
Es galt Deutschland zu beruhigen. Zuviel Bosheit hätte es veranlassen können seine moderaten Pläne zum Flottenausbau zu überdenken. Um deutsches Mißtrauen zu beseitigen, lockte England mit einem Neutralitätsangebot. Am 29. Januar 1912 bat Ballin um Audienz beim Kaiser. Er kam im Auftrag des englischen Bankiers Sir Ernest Cassel, der mit Kenntnis und Billigung der Regierung (wenn auch nicht des Parlaments und der Öffentlichkeit) die britische Neutralität, bei einem unprovozierten Angriffskrieg gegen das deutsche Flottenprogramm eintauschen wollte [46].
Ballin schlug nachdem Cassel gegangen war, die Hände über'm Kopf zusammen und rief: Heiliger Konstitutionalismus, angesichts dessen, wie der Bote des Mutterlandes der Konstitution, Cassel jegliche konstitutionellen Formen mißachtete. Der Kaiser witterte eine Finte. Gemeinsam mit dem deutschen Kanzler formulierte er eine Antwortnote, die die Sirenen des englischen Außenministeriums in ihren schönsten Tönen erklingen ließ. Es kam zu Verhandlungen und England bestimmte Richard B. Haldane zum Verhandlungsführer.
Haldane verhandelte — auch dann noch, als es nichts mehr zu verhandeln gab, d.h. als die deutsche Seite den britischen Vorschlag, das Stärkeverhältniss beider Flotten zugunsten der Engländer auf 10 : 16 festzulegen, angenommen hatte. Deutschland sollte die Hoffnung auf eine gütliche Einigung nicht genommen werden.
Tirpitz: »Bei diesen zuerst durch private Unterhändler gepflogenen und von englischer Seite mehrfach stark verschleppten Unterhaltungen gewann ich je länger, desto bestimmter den Eindruck, daß es der englischen Regierung mit einer wirklichen Flottenverständigung nicht ernst war,... [47]«
Der britische Unterhändler Richard Haldane war Kriegsminister, Mitglied des CID (Committee of Imperial Defence) und Verhandlungen eine Kriegslist. Er nutzte sie dazu, die auf Verständigung mit England angelegte Politik des deutschen Kanzlers aber auch die der britischen Kriegsgegner (u.a.: Viscount Morley of Blackburn, Arthur Ponsonby, Edmund Morel) auszumanövrieren.
Im Manchester Guardian stand zu lesen [48]:
„Haldane war hauptsächlich in der Flottenfrage interessiert, und sein durchgängiges Argument, daß eine politische Verständigung unreal bliebe, solange Deutschland nicht einige Flottenzugeständnisse machte, erleichterte die Niedergeschlagenheit des Kanzlers nicht, der indes entschlossen war, wenn er irgend vermochte, den Gedanken an Verständigung mit England nicht an Tirpitz scheitern zu lassen.“

Am Ende von Haldanes Mission stand die Drohung Greys und Haldanes anläßlich des 1912 herrschenden Balkankrieges, in einem sich ausweitenden Konflikt, gegen das Deutsche Reich ins Feld zu ziehen. Kaiser Wilhelm II. berief für den 8. Dezember 1912 den Kriegsrat ein. Erörtert wurden die strategische Lage Deutschlands und Optionen seiner Verteidigung erwogen. Das Ergebnis des Kriegsrates war bescheiden und fuhr unter Wasser: Es wurde der massive Ausbau der U-Bootsflotte beschlossen [49].